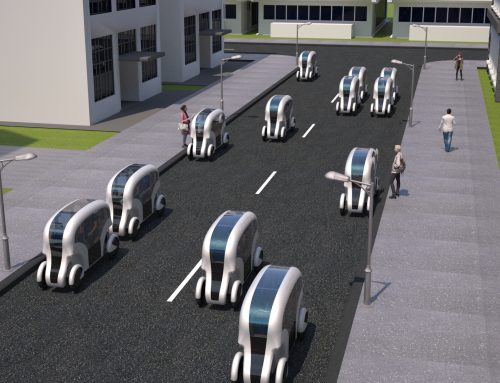MENDIG. -rro- „Leon will leben“ – das war auf den T-Shirts einiger Helfer bei der DKMS Typisierung in der Mendiger Laacher- See-Halle zu lesen. Leon – das ist ein gerade mal 19 Jahre alter Junge, der an Blutkrebs erkrankt und nun auf der Suche nach dem passenden Stammzellen-Spender ist. Ich habe mich auf eine kleine Achterbahnfahrt der Gefühle begeben und mich ebenfalls typisieren lassen.
Müsste, könnte, sollte. . .
„Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.“ So eingängig der Slogan der Deutschen Knochenmarkspenderdatei auch ist – so schnell verflüchtigte sich bisher bei mir leider immer wieder der Aktionismus, mich selbst registrieren zu lassen.
Eigentlich müsste man das ja mal machen, eigentlich könnte man sich ja mal registrieren lassen, eigentlich sollte man doch helfen – aber von müsste, könnte, sollte hat am Ende des Tages doch niemand etwas – außer mir: Nämlich das schlechte Gewissen darüber, die Chance zu helfen nicht ergriffen zu haben.
Und dann hatte die Krankheit ein Gesicht
Jeden Tag schwemmt eine Flut von E-Mails mit unterschiedlichen Themen die Redaktion. Die einen bedeutsamer als die anderen – doch dann kam die eine E-Mail, die mich nicht mehr los ließ: „Bitte um Mitnahme in so vielen Ausgaben wie möglich“, lautete der Betreff. In der Nachricht ging es um die Ankündigung zur Typisierungsaktion in Mendig, bei der ein Knochenmarkspender für den 19-jährigen Leon gesucht wird, der an Knochenkrebs erkrankt ist. Ich saß also an meinem Redaktionsschreibtisch und immer wieder hallte es in meinem Kopf nach:
„19. . , Knochenkrebs. . .“ Ich schaute mir das Foto von Leon an und plötzlich wurde es real – die Krankheit bekam ein Gesicht und ich entschied, zu handeln und nicht nur darüber zu schreiben. Hätte, könnte, sollte wich einem festen Entschluss.
Ein schöner Tag, um Gutes zu tun
Da bin ich nun, unterwegs nach Mendig, in die Laacher See Halle – fest entschlossen, mich typisieren zu lassen. Kamera und Notizbuch mit im Gepäck. Ich fahre die Straße entlang, will links auf den Parkplatz der Halle abbiegen und werde von einer Dame freundlich weitergewunken: Der Parkplatz ist schon voll. Und auch die Parkplätze entlang der Straße – alle belegt.
Nachdem ich mein Auto abgestellt habe, mache ich mich zu Fuß auf den Weg. Es ist Samstag, die Sonne scheint – es sieht so aus, als habe sich der Frühling nun doch entschlossen, stattzufinden. Ein wenig Aufregung macht sich schon bei mir breit. Ich habe nur eine grobe Vorstellung davon, wie die Typisierung ablaufen wird, und bin gespannt, auf welche Menschen ich vor Ort treffe.
Schlange stehen für den guten Zweck
Es ist mittlerweile 20 Minuten nach drei, als ich die Laacher-See-Halle erreiche. Und was ich sehe, lässt mich staunen: Die Menschen stehen Schlange. Brav aufgereiht warten sie darauf, von den Helfern in ihren roten T-Shirts zur Typisierung aufgerufen zu werden. Schlechte Laune hat hier aber niemand.
„Es ist wirklich unglaublich, wie geduldig die Leute sind“, erzählt mir später Christopher Wittig, Teilbereichsleiter für Soziales bei der Stadt Mendig und Organisator der Typisierungsaktion. „Es sind so viele gekommen, damit hatten wir gar nicht gerechnet.“ So viele – das sind mehr als 1500 Menschen aus der Region und darüber hinaus. Geplant hatte Wittig mit etwa einem Drittel dieser Zahl.
Lange drei mal
drei Minuten
Dann bin auch ich an der Reihe. Mir gegenüber sitzt eine freundliche Dame aus dem Helfer-Team und erklärt mir ganz genau, was zu tun ist. Ich bin gespannt und folge ihren Anweisungen, während sie meine persönlichen Daten aufnimmt: ethnische Zugehörigkeit, Größe und Gewicht, Erkrankungen oder Allergien – Kriterien, die darüber entscheiden, ob ich als Spender überhaupt in Frage komme.
„Bei den Gewebemarkern, nach denen ein passender Spender ermittelt wird, spielt die DNA eine Rolle – daher eben auch die ethnische Zugehörigkeit“, erklärt mir Bettina Steinbauer von der DKMS.
Ich bekomme nacheinander drei lange Wattestäbchen gereicht. Mit dem ersten streiche ich genau drei Minuten an der rechten Innseite meiner Wange entlang. Dann ist die linke Seite dran, zum Schluss das gleiche Spiel einmal rund herum. Zugegeben, drei Minuten können tatsächlich ganz schön lange dauern. Denn es fühlt sich schon irgendwie etwas befremdlich an, sich inmitten fremder Menschen mit einem Wattestäbchen im Mund herum zu pulen.
Heute retten wir ein Leben
„Heute retten wir ein Leben, selbst wenn wir niemanden für Leon finden – dann aber für jemand anderen.“
Dieser Satz begegnet mir immer wieder: Nicht als Plattitüde, sondern von Menschen, die mich dabei gerührt und emotional ergriffen und zum Teil mit Tränen in den Augen anschauen. So wie Leons Mutter Simone, die heute auch hier ist und kaum fassen kann, dass so viele Menschen gekommen sind, um ihrem kranken Sohn zu helfen.
„Wir mussten erst einmal lernen, damit umzugehen, dass wir im Moment so im Mittelpunkt stehen“, sagt sie. Lächelt und muss zugleich ihre Tränen zurückhalten.
Auch mich berührt die Unterhaltung mit ihr sehr. Die ganze Situation wird nun noch realer. Erst gab es nur dieses Bild – ein Foto, das einen fröhlichen jungen Mann mit seiner Freundin zeigt, und der nun schwer krank in einer Klinik gegen den Krebs kämpft.
Jetzt stehe ich vor seiner Mutter, die mir mit einem hörbaren Kloß im Hals sagt, sie sei nicht so gut darin, die richtigen Worte zu finden, und mich dabei freundlich anlächelt.
Die Angst vor der Nadel
Nachdem die Wattestäbchen sicher in einem Umschlag verpackt sind, geht es damit zur nächsten Station. Dort werden die Umschläge gesammelt, um in ein Labor geschickt zu werden, das die Gewebemarker analysiert und in die Datenbank der DKMS aufnimmt.
einem Umschlag verpackt sind, geht es damit zur nächsten Station. Dort werden die Umschläge gesammelt, um in ein Labor geschickt zu werden, das die Gewebemarker analysiert und in die Datenbank der DKMS aufnimmt.
„Aus jeder einer solchen Aktion geht mindestens ein Spender hervor, das ist gewiss“, erklärt Bettina Steinbauer.
Doch was, wenn man wirklich als Spender ausgewählt wird? Muss ich dann ins Krankenhaus? In meinem Kopf läuft ein Film ab, der mir im ersten Moment eher Unbehagen bereitet. Aber meine Sorge ist unbegründet – denn 80 % der Knochenmarkspenden funktionieren ganz ohne Nadel – naja fast.
Bei der so genannten peripheren Entnahme, wird das Knochenmark aus der Blutbahn entnommen – einen kleinen Pikser gibt es also schon. Doch der ist nicht schlimmer als bei einer gewöhnlichen Blutabnahme. In 20% der Fälle, sieht man sich dann aber doch einem operativen Eingriff gegenüber, bei dem das Knochenmark aus dem Beckenkamm entnommen wird.
Nach vier Wochen – so ist bei der DKMS zu lesen – sei man dann aber auch wieder fit. Und was sind schon vier Wochen im Verhältnis zu einem ganzen Leben?